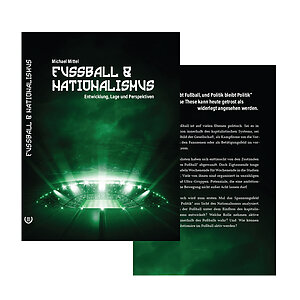Im Herbst 2021 hält die Partei Der III. Weg ein Schulungswochenende im parteieigenen nationalen Zentrum im sächsischen Plauen ab. Inhalt des Schulungswochenendes sind Grundlagen der Kommunistischen Ideologie. Es geht um Materialismus, das Scheitern der marxistischen Ideologie in der Praxis und die Entwicklungen des Marxismus seit dem Untergang der Sowjetunion. Die Teilnehmenden sollen dadurch das Weltbild des politischen Gegners verstehen und die Schwächen kommunistischer Theorien aufzeigen können.
Neben solchen Schulungswochenenden ist die Beschäftigung mit dem Weltbild des politischen Gegners auch regelmäßig Thema auf der Website der Partei oder in verschiedenen Grundlagenbüchern. Das Interesse zeigt, dass es dem III. Weg nicht reicht, mit Gewalt zu überzeugen. Bei politischen Diskussionen soll ebenfalls die eigene Überlegenheit dargestellt werden. Das Hauptinteresse liegt hier klar bei einer Auseinandersetzung mit kommunistischer Ideologie. Anarchistische Theorien oder andere sozialistische Ideen spielen keine größere Rolle. Das mag aus historischen Gründen nachvollziehbar sein, da marxistische Theorien in der BRD die wichtigste Rolle bei linken Protesten gespielt haben. Die seit dem Aufkommen der Autonomen Bewegung wieder stärker verbreiteten anarchistischen Theorien, sowie alle anderen sozialistischen Ideen fallen damit jedoch unter den Tisch.
Platon über alles
Der III. Weg sieht sich als politische Kraft, die einen Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus beschreitet. Im letzten Kapitel haben wir uns deshalb mit der Abgrenzung der Partei zum Kapitalismus beschäftigt. Der Kapitalismus versucht demnach durch die Ausbeutung der Menschen, einer gezielt herbeigeführten Zuwanderung von Millionen Migrant*innen und dem Eintrichtern liberaler Werte, das Deutsche Volk zu zerstören. Das Feindbild ist damit klar abgesteckt. Beim Kommunismus stellt sich die Abgrenzung etwas komplizierter dar. Die im ersten Kapitel behandelte Utopie des III. Wegs heißt schließlich Deutscher Sozialismus. Das Wort Sozialismus ist für die meisten Menschen klar kommunistischen oder zumindest linken Ideen zuzuordnen. Auch der Kampf gegen Ausbeutung oder Begriffe wie „revolutionär“ werden mit Kommunist*innen in Verbindung gebracht. Die Lösung für dieses offensichtliche Abgrenzungsproblem sieht der III. Weg in einer Umschreibung der Geschichte des Sozialismus.
Der Sozialismus wird in der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung als eine politische und wirtschaftliche Bewegung gesehen, die im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die sozialen und wirtschaftlichen Missstände entstand, welche Kapitalismus und Industrialisierung auslösten. In der Folge entwickelten sich viele verschiedene Strömungen, die sich mal mehr mal weniger voneinander unterscheiden. Seit der Entstehung des Sozialismus fragen sich Menschen auch, ob Ideen, die vor dem 19. Jahrhundert entstanden sind, als sozialistisch bezeichnet werden können. Beliebt sind an dieser Stelle verschiedenste antike Philosoph*innen, Widerstandsbewegungen gegen unterdrückerische Herrschaftssysteme und Menschengruppen aus der Ur- und Frühgeschichte, denen eine besonders gerechte Form des Zusammenlebens nachgesagt wird.
Da der III. Weg den Sozialismus des 19. Jahrhunderts mit seinen Ideen von Klassenkampf, internationaler Solidarität und herrschaftsfreier Gesellschaft nicht als direktes Vorbild nehmen kann, sucht er sich einen dieser angeblichen Vorläufer des Sozialismus stattdessen als Vorbild. Die Wahl fällt auf den Sozialismus nach Platon. Platon hat in seinem Werk Politeia eine gerechte Gesellschaft entworfen, welche darauf beruht, dass Menschen in Harmonie miteinander leben und jeder gemäß der eigenen Fähigkeiten in der Gesellschaft wirken kann. Die Herrschenden dieser Gesellschaft sind wenig überraschend die Philosophen, die durch Wissen, Weisheit und moralische Integrität die besten Entscheidungen treffen können. Neben dieser herrschenden Klasse gibt es noch eine Wächterklasse und die Produzent*innen. Damit die Wächter und Herrscher ihre Macht möglichst nicht missbrauchen, dürfen sie kein Privateigentum besitzen und keine Kernfamilien haben, denen sie Vorteile verschaffen könnten. Die Ideen Platons sind insbesondere für die Zeit in der er lebte außergewöhnlich, doch vom Sozialismus des 19. Jahrhunderts unterscheiden sie sich stark.
Der III. Weg geht den bemerkenswerten Schritt, dass er nicht nur Platons Ideen in einer Reihe mit dem modernen Sozialismus sieht. Der Sozialismus des 19. Jahrhunderts wird von der Partei sogar als Irrweg bezeichnet. Dazu wird neben der sozialistischen Linie seit Platon noch eine andere antike Gesellschaft mit dem Sozialismus in Verbindung gebracht. Denn auch die Germanen sind angeblich frühe Sozialist*innen gewesen. Erst Rom und die christliche Kirche konnten die freien Vorfahren der Deutschen brechen, ihren Boden kommerzialisieren und aus ihnen eine Herde von Ackersklav*innen im Dienste der römischen Papstkirche machen. Erst unter Friedrich dem Großen flammte dann angeblich die deutsch-soziale Gemeinnützigkeitgesinnung wieder auf und wurde anschließend von der liberalkapitalistischen Revolution von 1848 wieder beerdigt. Weitere Meilensteine in einer sozialistischen deutschen Geschichte sind selbstverständlich Otto von Bismarck mit seinen Sozialgesetzen und die NS-Zeit.
Diese wilde Zusammensetzung von Stammesgesellschaften, griechischen antiken Theoretikern und für den deutschen Nationalismus besonders wichtigen Herrschern ist alleine schon deshalb schwer zu kritisieren, weil man nicht weiß wo man anfangen soll. Daher ist es sinnvoll sich auf zwei große Kritikpunkte zu beschränken. Der erste Kritikpunkt ist, dass offensichtlich nicht hinterfragt wurde, welche Theoretiker und Gesellschaften zu den eigenen Ideen passen. Es ist sehr offensichtlich, dass hier nur Beispiele für eine neue Geschichte des Sozialismus gesucht wurden, während ein ergebnisoffenes Verständnis der verschiedenen Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt gewünscht war. Der III. Weg nimmt jedes Klischee über Kulturen und Herrscher auf, solange es in die eigene Erzählung passt. Alleine Platons Gesellschaftsideen und das Stammesleben von Germanen in eine Traditionslinie zu packen ist mehr als gewagt. Wenn dann noch die modernen Herrscher dazukommen bleibt nur als Gemeinsamkeit, dass alle mal irgendwas soziales gemacht haben. Nun liegt die Messlatte derart niedrig, dass jedes politische System in dieser Aufzählung vorkommen könnte. Das ist auch höchst notwendig, denn im Vergleich zu anderen Zeitgenoss*innen fallen weder Friedrich der Große noch Otto von Bismarck durch besonders soziale Politik auf. Der III. Weg steht vor dem Dilemma, dass sie trotz ihrer angeblichen sozialistischen Tradition nicht von den Galionsfiguren des deutschen Nationalismus lassen können, die eine größere Teilhabe von Ressourcen und Macht durch die armen Menschen ihrer Zeit entschieden bekämpft haben.
Der zweite Kritikpunkt ist, dass in dieser Aufzählung die Überlegenheit des Deutschen Volkes endgültig beerdigt wird. Der Deutsche Sozialismus wurde laut der Geschichte des Sozialismus des III. Wegs mindestens vier mal erreicht. Die Germanen lebten im deutschen Sozialismus, Friedrich der Große und Otto von Bismarck ebenfalls, sowie selbstverständlich auch die Nationalsozialisten. Für eine Ideologie, die sich auf die biologische Überlegenheit des eigenen Volkes beruft und die durch ihr völkisches Zusammenleben mit besonderen Eigenschaften gesegnet ist, kann es doch kaum befriedigend sein, wenn die eigene Utopie immer wieder beendet wurde. Wenn es also die Römer, Napoleon, die Revolution von 1848 und die Alliierten geschafft haben den Deutschen Sozialismus zu besiegen, stellt sich die Frage warum man denn überhaupt so viel auf dieses deutsche Volk halten sollte. So groß können die biologischen Vorteile nicht sein, wenn der Deutsche Sozialismus immer wieder besiegt wird.
Die Verfälschung des Sozialismus
Nachdem eine eigene Geschichte des Sozialismus geschrieben wurde, bleibt noch die Kritik an den Ideen und politischen Projekten, die in der Gesellschaft eigentlich unter Sozialismus verstanden werden. Die Aufgabe ist nicht leicht, denn seit der Entstehung des Sozialismus im 19. Jh. haben unzählige Menschen mit ihren Theorien und politischen Projekten die politische Landschaft des Sozialismus bereichert. Doch wer die letzten Kapitel unserer Analyse bereits gelesen hat, weiß was jetzt kommt. Natürlich hat der III. Weg nicht versucht diese Vielfalt an politischen Ideen einzuordnen. Stattdessen wird das zusammengewürfelt was irgendwie in der Gesellschaft unter Sozialismus verstanden wird. Das betrifft die real existierenden sozialistischen Staaten, den autoritären Kommunismus und Karl Marx.
Für den III. Weg ist der Kern der kommunistischen Ideologie das Beseitigen der bestehenden tiefgreifenden materiellen Ungerechtigkeiten. Denn im Gegensatz zum deutschen Sozialismus, der einer angeblichen biologischen Überlegenheit des deutschen Volkes entspringt, soll der Kommunismus davon ausgehen, dass nur die Umwelt und unser soziales Gefüge auf unsere Chancen in der Gesellschaft Einfluss haben. Der III. Weg geht nämlich davon aus, dass alle Kommunist*innen radikale Anhänger der Milieutheorie sind.
Laut dieser Theorie sind Menschen ausschließlich durch Einflüsse und Erfahrungen der Lebenswelt geprägt. Genetische Anlagen haben danach keine Bedeutung. Das Problem ist nur, dass die Milieutheorie keine einheitliche Grundlage des Kommunismus ist. Stattdessen gehen auch die meisten Kommunist*innen von einem Mix genetischer und gesellschaftlicher Faktoren aus, die je nach Lebenssituation und Entwicklung unser Leben bestimmen. Da die genetischen Voraussetzungen der Menschen aber sehr vielfältig und gewöhnlich nicht veränderbar sind, beschäftigt sich der Kommunismus mit den gesellschaftlichen Umständen, die durchaus verändert werden können.
Die große Veränderung des Kommunismus in diesen gesellschaftlichen Umständen ist angeblich eine neue Verteilung der Reichtümer der Gesellschaft. Damit unterscheidet er sich für den III. Weg vom Kapitalismus, der das Kapital im Blick hat und vom Deutschen Sozialismus, der für die Gemeinschaft steht. Damit seien Kommunismus und Kapitalismus in erster Linie materialistisch, während der Deutsche Sozialismus vor allem idealistische Werte vertritt. Diese Logik sorgt dafür, dass für den III. Weg Kapitalismus und Kommunismus nur zwei Seiten derselben Medaille sind. Aufgrund dieser Ähnlichkeit ist der Kommunismus auch nicht in der Lage, den Kapitalismus zu ersetzen. Warum diese angebliche Ähnlichkeit ein Ersetzen ausschließt wird nicht näher erklärt.
Passenderweise funktioniert die Umverteilung der gesellschaftlichen Reichtümer auch einfach nicht. Denn ohne den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft sind die Menschen angeblich überhaupt nicht in der Lage, die Gewinne gerecht untereinander zu verteilen. Wenn wir in einer modernen multikulturellen Gesellschaft leben, sorgen die unterschiedlichen Mentalitäten nämlich nur für dauerhaften Streit. Ohne die völkische Gemeinschaft will niemand zurückstecken und eine gerechte Verteilung ist unmöglich. Außerdem würde die bereits aus dem Kapitalismus bekannte Verschwörung der Hochfinanz diese Verteilung gar nicht zulassen. Denn für einen Sieg gegen diese mächtigen Kräfte braucht es praktischerweise die Volksgemeinschaft.
Wie auch schon bei der Kapitalismuskritik des III. Wegs fügt sich an dieser Stelle wieder ein Puzzleteil ins Andere. Die Hochfinanz ist genau so mächtig, dass eine Klasse sie nicht besiegen kann, sondern nur das gesamte Deutsche Volk. Eine Grenzüberschreitende Solidarität wird aufgrund von kulturellen Unterschieden praktischerweise ausgeschlossen, denn sonst wäre zu offensichtlich wie viel größer das Potenzial einer Klassensolidarität gegenüber einer nationalen Solidarität wäre. Doch wenn die grenzüberschreitende Solidarität nicht möglich ist, stellt sich die Frage warum nicht einfach vermehrt kommunistische Ideen im Deutschen Sozialismus verwendet werden. Dass auch in Deutschland ökonomische Ungerechtigkeit herrscht, leugnet die Partei schließlich nicht.
Bei der Frage der Verteilung der gesellschaftlichen Reichtümer schlägt sich der III. Weg wie zu erwarten auf die Seite des Kapitals. Denn die ökonomischen Unterschiede sind zwar da, aber sicherlich auch gerechtfertigt. Persönliches Risiko, organisatorische Fähigkeiten oder der lange mühsame Weg des gesellschaftlichen Aufstiegs sind hierfür vorgebrachte Indizien. Ohne diese Tatsachen zu benennen, stachelt der Kommunismus die Massen durch puren Neid gegen die besser gestellten Teile der Gesellschaft auf. Den Massen wird vorgegaukelt, dass die ökonomischen Unterschiede auf ungerechten Vorteilen basieren und der deutsche Arbeiter will jetzt natürlich nicht ungerecht gewesen sein und bleibt seiner ökonomischen Klasse treu. Damit nehmen Kommunist*innen dem Arbeiter seinen Ehrgeiz gesellschaftlich aufzusteigen, denn er braucht ihn schließlich als Arbeiter. Sonst wäre der Arbeiter Mittelständler und hätte kein Interesse mehr an kommunistischen Ideen. Fortgesetzt wird damit ein Kreislauf nach unten, der nur Verlierer kennt und bei dem alle im Elend versinken. Ehrlicher Lohn und ehrliche Arbeit rücken damit für den Arbeiter in weite Ferne.
Den geneigten Leser*innen ist sicherlich aufgefallen, dass die heutzutage weitaus relevanteren Ideologien antiautoritärer Kommunist*innen, Anarchist*innen und Sozialist*innen nicht Gegenstand dieser Kritik sind. Diese Ideologien haben sich am Aufbau der bekannten real existierenden sozialistischen Staaten wenn nur in ihrer Entstehung beteiligt und wurden als Abweichler brutal verfolgt. Auch die zumindest zeitweise erfolgreichen Versuche dieser politischen Strömungen ihrer Ideen zu verwirklichen, werden nicht wahrgenommen. Bei der sozialen Revolution in Spanien oder der Machnowtschina ist dies noch nachvollziehbar, schließlich existierten sie vor vielen Jahrzehnten. Dass aber autonome Gebiete wie die Zapatistas in Mexiko oder Rojava nicht vorkommen, zeigt wie wenig Ahnung der III. Weg von der aktuellen linken Bewegung hat.
Allerdings wird am Rande immer wieder Bezug auf den antiautoritären Kommunismus genommen. Im von der Partei veröffentlichten Buch „Fussball und Nationalismus“ wird am Ende eine nationalistische Kopie von antifaschistischen Fussballvereinen gefordert, die sich gegen die Kommerzialisierung ihres Sports stellen und aus diesem Grund eine eigene Fussballliga mit eigenem Verband gegründet haben. Diese Bewegung zeichnet sich durch Selbstorganisation, soziale Teilhabe und der größtmöglichen Mitbestimmung von allen Beteiligten aus. Eine Kritik an diesen Ideen wird nicht geäußert, sondern nur eine eigene Liga als Konkurrenz dazu erörtert.
Der Anarchismus hat, wenn er überhaupt von der Partei erwähnt wird, ein noch schwierigeres Los als der autoritäre Kommunismus gezogen. Nicht etwa seine klassenkämpferischen Wurzeln, die breite Selbstorganisation oder die Kollektivbewegung wird mit ihm verbunden. Stattdessen wird er mit der bis vor einigen Jahren noch vollkommen nebensächlichen Marktradikalen Strömung so genannter „Libertärer“ in einen Topf geworfen. Privatisierung auf Teufel komm raus und ein möglichst ungezügelter freier Markt ohne staatliche Kontrolle werden mit dem Anarchismus verbunden. Dazu kommen noch die altbekannten öffentlichen Bilder von Steine schmeißenden Chaot*innen, die nur ihre individuellen Vorteile im Sinn haben. Doch dass Anarchismus für viele Menschen auch etwas anderes bedeutet, ist auch dem III. Weg nicht vollkommen entgangen. Auch hier deckt sich die Sichtweise der Partei mit der bürgerlichen Betrachtung des Anarchismus. Das freie Zusammenleben von Menschen ohne staatliche Gewalt und Ordnung bezeichnet die Partei als naiv. Das ist wenig überraschend, schließlich ist die Nation für die Faschist*innen das höchste Gut.
Fazit
Die Kritik des III. Wegs am Kommunismus fußt auf einer neuen Geschichte des Sozialismus und der Ablehnung der historisch bedeutendsten kommunistischen Strömung dem autoritären Kommunismus. Damit verfehlt der III. Weg zumeist sein Ziel, dass die Parteimitglieder konkurrierende linke Kräfte überzeugen oder argumentativ niederringen können. Besonders deutlich macht dies die Beschäftigung beim Seminarwochenende in Plauen, bei dem kommunistische Theorien behandelt werden, die außerhalb von tiefroten Splittergruppen nur noch wenig Einfluss haben. Aktuelle sozialistische Gesellschaftsentwürfe und moderne Theorien sind scheinbar nicht wirklich bekannt.
Wie auch sonst scheint die Partei eher an einer oberflächlichen Analyse interessiert, denn ansonsten müsste sehr viel mehr Zeit und Energie in das Verständnis vom politischen Gegner gesteckt werden. Das zentrale Thema für die Partei ist die Verelendung der Menschen durch sozialistische Ökonomien. Die Verelendung wird zum einen mit planwirtschaftlichen Fehlern und der Ausschaltung kapitalistischer Marktmechanismen begründet, zum anderen wollen die Kommunist*innen auch angeblich die Menschen klein halten, weil sie sonst durch ihren ökonomischen Status ihrem Zugriff entwachsen würden.
Bei der Betrachtung der real existierenden sozialistischen Staaten wie auch anderen sozialistischen Versuchen zeigt sich durchaus, dass eine Gesellschaft mit guten ökonomischen Lebensverhältnissen für alle keine leichte Aufgabe ist. Insbesondere im Systemvergleich zeigten die verschiedenen sozialistischen Staaten eine Unterlegenheit in ökonomischen Fragen gegenüber dem Kapitalismus. Eine Ausnahme bildet die Volksrepublik China mit ihrem rasanten Aufstieg in den letzten Jahrzehnten. Doch hat diese in der Vergangenheit viele sozialistische Prinzipien abgelegt und eine starke Öffnung für marktwirtschaftliche Vorgehensweisen betrieben.
Es ist allerdings doch durchaus zweifelhaft, ob der Kommunismus eine Verelendung der Menschen herbeigeführt hat. Schließlich musste ein Großteil der sozialistischen Staaten erst einmal die Zerstörung des durch Faschist*innen herbeigeführten Zweiten Weltkriegs überwinden. Dazu kommt, dass im zaristischen Russland, dem vorindustriellen China und den meisten anderen Vorläuferstaaten der sozialistischen Staaten die Lebensbedingungen für die Menschen dermaßen schlecht waren, dass selbst die zweifelhaften Methoden in den real existierenden sozialistischen Staaten die Lebensbedingungen klar verbessern konnten.
Es ist zwar durchaus richtig, dass die kapitalistischen Staaten sich weitaus besser ökonomisch entwickelt haben, allerdings war der Kommunismus nie darauf ausgelegt, den Kapitalismus zu überflügeln. Die radikale Ausbeutung von Mensch und Natur machen den Kapitalismus zu der wohl innovativsten Wirtschaftsform überhaupt. Nur nützt einem das wenig, wenn man nicht zu den Gewinnern dieses Systems gehört. Faschist*innen vergessen auch gerne bei ihrer Kritik des Sozialismus wie die eigenen politischen Versuche ökonomisch geglückt sind. Im Nationalsozialismus hat die Kriegswirtschaft zwar ihren Zweck erfüllt, doch am Ende hat sie ein zerstörtes Land hinterlassen. Ganz zu schweigen von den Entbehrungen durch die Kriegsvorbereitungen, die bei vielen deutschen Kindern zu Mangelernährung führten. Auch weniger kriegerische faschistische Systeme wie Spanien unter Franco waren nicht gerade für ihren großen wirtschaftlichen Aufschwung bekannt.
Besonders unsinnig ist aber der Vorwurf, dass Kommunist*innen die Arbeitenden vom Aufstieg in den Mittelstand abhalten wollen würden, damit diese ihnen weiter zugeneigt sind. Denn der Mittelstand ist im Kapitalismus keine unendlich wachsende Gruppe. Frei nach Brechts bekanntem Zitat „Wär ich nicht arm, wärst du nicht Reich“ muss an dieser Stelle erwidert werden, dass der Kapitalismus ohne Ausbeutung nicht funktioniert. Wenn alle Menschen die Möglichkeit hätten im bestehenden System aufzusteigen, dann würden sie es tun. Am Ende ist dieses Versprechen wie der gesamte Antikapitalismus des III. Wegs nichts als eine Mogelpackung für die lohnabhängige Klasse.